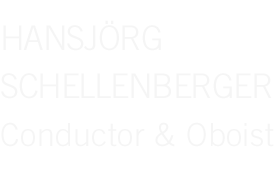Fünfundsiebzig Jahre sind vergangen, seit der junge amerikanische Soldat und Oboist John de Lancie von dem greisen Richard Strauss wissen wollte, ob er womöglich bereit sei, ein Konzert für das reizvolle Doppelrohrblattinstrument zu schreiben.
Das klare »Nein« war etwa so definitiv wie Anton Bruckners Aussage, dass Harfen in einer Symphonie nichts zu suchen hätten – es hielt keinen Sommer: Schon wenige Monate nach der abschlägigen Antwort erfuhr der nachmalige Oboist des Philadelphia Orchestra und Vater des als »Q« (Startrek) berühmt geworden Schauspielers John de Lancie, das ein Oboenkonzert entstanden sei und Strauss ihm sogar die amerikanischen Erstaufführungsrechte eingeräumt habe.
Dass er dieselben nicht wahrnehmen konnte, lag nicht am Komponisten, sondern an der hierarchischen »Hackordnung« innerhalb des Orchesters, in dem de Lancie ein »Junior« war: Er konnte sich indes damit trösten, dass ihm Jean Françaix später seine Horloge de flore gewidmet hat – und dass auf Grund seiner kecken Frage eines der zauberhaftesten Konzertstücke nicht nur des 20. Jahrhunderts, sondern der gesamten Oboenliteratur überhaupt entstanden war, das sich seit vielen Jahrzehnten gleichbleibender Beliebtheit erfreut.
In all den Jahren seiner Existenz hat das Konzert jedoch unter mancherlei Fehleinschätzungen und Missverständnissen sowie unter etlichen, seit der Drucklegung im Jahre 1948 perpetuierten Satzfehlern gelitten, die den Oboisten und Dirigenten Hansjörg Schellenberger – einen wahrlich profunden Kenner des Werkes und des Strauss’schen Œuvres insgesamt – dazu veranlasst haben, für den Henle Verlag eine neue Urtextausgabe herzustellen, aus der nach gründlichster Einsicht in das originale Noten- und briefliche Quellenmaterial nicht allein die letzten Druck- und Lesefehler entfernt wurden.
Unter Bezug auf den Briefwechsel des Komponisten mit seinem Freund Ludwig Kusche, hat sich Hansjörg Schellenberger in seinem begleitenden Essay auch mit der wichtigen Frage der Tempi und Temporelationen auseinandergesetzt und dabei entdeckt, dass vieles, was uns heute an der serenen, beglückenden Verneigung vor Wolfgang Amadeus Mozart so vertraut erscheint, bei genauer Beachtung Strauss’scher Gewohnheiten und Auffassungen inskünftig einiger Revisionen bedarf.
Das betrifft die Einstellung zu dem klassischen »Andante« – für Strauss eine gemächlich schlendernde, keineswegs schleppende Angelegenheit – nicht weniger als den Umgang mit den reichen, üppig rankenden Ornamenten des bzw. der Solisten, die der Komponist nicht minutiös ausgespielt, sondern als Schattierungen und Tönungen verstanden wissen wollte; und es betrifft insbesondere die letzten Seiten der Partitur mit dem veränderten Schluss, den Richard Strauss, wie aus dem Briefwechsel mit seinem Verleger erhellt, noch kurz vor seinem Tode einer Bearbeitung unterzogen hat. Ein Moment des Innehaltens, ein zarter Blick zurück in eine Vergangenheit, die immer Gegenwart bleiben wird … dann löst sich alles in einer schwungvollen, zugleich aber in sich ruhenden Stretta, die sich über alle Zeitfragen und Zeiten erhebt.